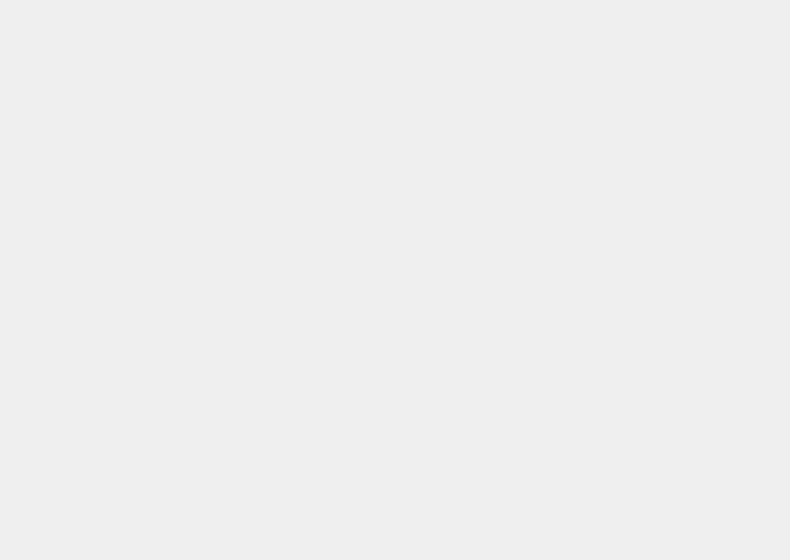Blinky Palermo
Flipper
1970
2-teiliger Farbsiebdruck auf weißem Offsetkarton
Je 86 x 66 cm
Inv.-Nr. 1074 und 1075
Museum Morsbroich, Leverkusen
Erworben 1972
Blinky Palermo
Leipzig 1943 (DE) – 1977 Kurumba (MV)
In Auseinandersetzung mit der klassischen Avantgarde, mit Joseph Beuys (bei dem er an der Düsseldorfer Kunstakademie studierte) und Yves Klein entwickelte Blinky Palermo (geb. Peter Heisterkamp) eine unverkennbar eigene, weitgehend abstrakte Bildsprache. Mit einem humorvollen Seitenhieb auf die weltanschaulich überhöhte Geometrie eines Piet Mondrian verwendet er in Flipper (1970) als Vorlage die karierte Verkleidung eines Flipperautomaten aus seiner Düsseldorfer Stammkneipe. Den Ansatz, das Triviale zum Bildmotiv zu erheben, teilte Palermo mit seinen Freunden Gerhard Richter und Sigmar Polke.
Was aussah wie ein abstraktes Gemälde der klassischen Moderne, übertrug Palermo dann in das „demokratische“ Medium der Druckgrafik. Schon 1975 wurden Drucke von Palermo in einer großen Einzelausstellung im Museum Morsbroich gezeigt. Im Siebdruck-Prozess entscheidet er spontan, das Zwischenprodukt in Weiß-Rot (noch ohne Blau) beizubehalten und mit dem dreifarbigen Blatt zu kombinieren.
In Flipper gelingt es Palermo, ein abstraktes Bildpaar mit den Blinklicht-Effekten einer Spielhalle zu assoziieren. Das Ringen mit der Frage, wie ein Bild auszusehen habe, verbindet sich spielerisch mit dem Kampf am Automaten, den Palermo in seiner Kneipe vehement geführt haben soll.