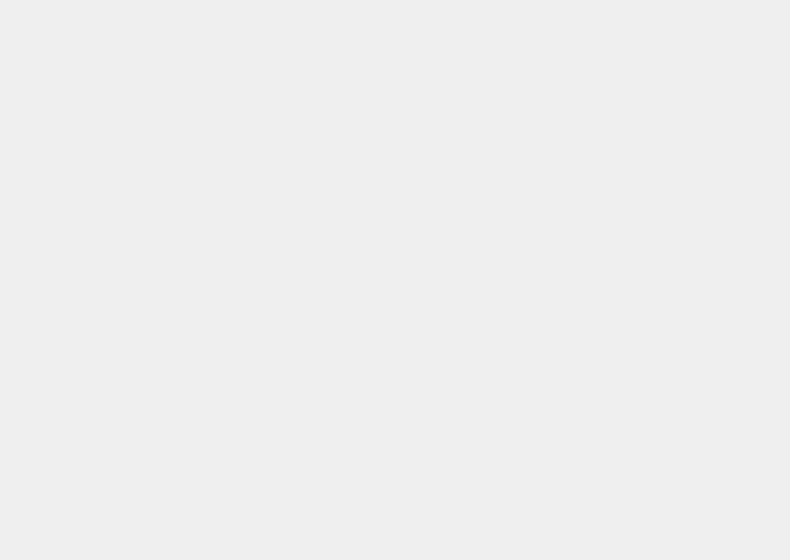Barbara Hepworth
Corymb
1959
Bronze
Höhe 30 cm
Inv.-Nr. 3051
Museum Morsbroich, Leverkusen
Erworben 1962
Barbara Hepworth
1903, Wakefield (UK) – 1975, St Ives in Cornwall (UK)
Für Barbara Hepworth bedeutet das Jahr 1939 eine tiefgreifende Zäsur. Angesichts des sich anbahnenden Krieges zieht sie nach Cornwall, woraufhin die dortige Landschaft zum Prisma ihres Schaffens wird.
In Zu den konzeptionellen Grundlagen ihrer Kunst befragt, äußerte sich Hepworth einmal folgendermaßen: „Die Formen, die seit meiner Kindheit für mich eine besondere Bedeutung haben, sind: die aufrechte Form (eine Übersetzung meines Gefühls einem Menschen gegenüber, der in einer Landschaft steht); zwei Formen (die zärtliche Beziehung zwischen zwei lebendigen Geschöpfen eines neben dem anderen); und die geschlossene Form, wie die ovale, runde oder durchbrochene Form […], in der für mich die Assoziation und Bedeutung einer Geste der Landschaft enthalten ist.“
In Die hieraus schöpfende Charakteristik ihrer Formsprache veranschaulicht die Bronzeskulptur Corymb (1959) auf beispielhafte Weise: Reduziertheit der Form, konstruktivistische Klarheit und rhythmische Ausgewogenheit präsentieren sich eingebunden in menschliches Maß, in eine mimetische Hingabe an die Erscheinungsvielfalt der Natur. Es sind die Emotionalität und die Verquickung mit der Natur, die der Kunst Hepworths, die unter anderem 1962 in der Gruppenausstellung Konstruktivisten